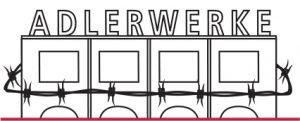Die Adlerwerke im Nationalsozialismus
Rundgang und anschließender Besuch des Geschichtsort Adlerwerke
Die Adlerwerke waren ein Frankfurter Traditionsbetrieb, der in der NS-Zeit eine unrühmliche Rolle spielte. Neben der Beschäftigung von Zwangsarbeitenden gab es ab August 1942 ein KZ-Außenlager auf dem Werksgelände. Über 1600 Häftlinge mussten dort unter unmenschlichen Bedingungen schuften, nur wenige überlebten. Der Rundgang spürt den noch vorhandenen Zeugnissen auf dem ehemaligen Werksgelände und im Stadtteil nach und endet mit einem Besuch des Geschichtsortes Adlerwerke. Fabrik, Zwangsarbeit, Konzentrationslager.
Termine:
So., 10.08., 14.00-15.30 Uhr
Mi., 13.08., 17.30-19.00 Uhr
So., 17.08., 14.00-15.30 Uhr
Kostenfrei, genauer Treffpunkt wird nach Anmeldung rechtzeitig bekannt gegeben.
Anmeldung: anmeldung@kz-katzbach-adlerwerke.de
Veranstalter:
Förderverein für die Errichtung einer Gedenk- und Bildungsstätte KZ-Katzbach in den Adlerwerken und zur Zwangsarbeit in Frankfurt am Main e.V.
Eine Veranstaltung im Rahmen der Route der Industriekultur
Wir trauern um Horst Koch-Panzner
- Mai 1954 – 28. Juli 2024
Horst Koch-Panzner war Gründungsvorsitzender des Fördervereins und maßgeblich beteiligt an der Eröffnung des Geschichtsort Adlerwerke.
Mehr
Buchveröffentlichung
Jean-François Ameloot / Herbert Bauch / Thomas Schmidt (Hrsg.): Französische Priester und Arbeiterjugendliche in geheimer Mission. Unter französischen Zwangsarbeitern in den Adlerwerken in Frankfurt am Main 1942–1945
Mehr Infos: www.brandes-apsel-verlag.de/
Neuer Vorstand gewählt
Auf der Mitgliederversammlung des Fördervereins am 6. Dezember 2023 wurde ein neuer Vorstand gewählt: Elke Sautner (Vorsitzende), Thomas Schweier (Stellv. Vorsitzender), Thomas Schmidt (Finanzen), Michael Weber (Schriftführer), Herbert Bauch (Beisitzer)
Geschichtsort Adlerwerke eröffnet!
Der Geschichtsort Adlerwerke wurde am 25. März 2022 eröffnet. Alles Wissenswerte zum Geschichtsort und den Besuchsmöglichkeiten finden Sie unter www.geschichtsort-adlerwerke.de
Betrieben wird der Geschichtsort Adlerwerke vom Studienkreis Deutscher Widerstand 1933-1945 e.V. Unterstützt wird die Arbeit vom „Förderverein für die Errichtung einer Gedenk- und Bildungsstätte KZ-Katzbach in den Adlerwerken und zur Zwangsarbeit in Frankfurt am Main“ und dem Dezernat Kultur und Wissenschaft der Stadt Frankfurt a.M.
Mit dem Geschichtsort Adlerwerke wird an ein Außenlager des Konzentrationslagers Natzweiler-Struthof erinnert, das sich in der Spätphase der NS-Diktatur in den Adlerwerken im Frankfurter Stadtteil Gallus befand. In dieses Lager wurden überwiegend polnische Männer verschleppt, die am Warschauer Aufstand (Sommer 1944) beteiligt waren. In den Adlerwerken mussten sie Sklavenarbeit leisten.
Während des Nationalsozialismus produzierten die Adlerwerke fast ausschließlich für die Wehr- macht und stiegen zum größten Hersteller von Schützenpanzer-Fahrgestellen auf. Bereits im Juli 1941 entstanden Baracken für französische Zivilarbeiter auf dem Gelände zwischen Werk I und II. Dieses Areal hatten die Adlerwerke zwischen 1936 und 1938 den jüdischen Unternehmern, die dort kleine Fabriken betrieben, abgepresst. Ab 1942 verschleppte man vor allem russische Kriegsgefangene nach Frankfurt, weshalb ein neues Massenquartier in der Froschhäuser Straße in Griesheim auf städtischem Grund entstand. Etwa 2.000 Zwangsarbeiter/innen mussten dort unter unmenschlichen Bedingungen hausen. 1943 beschäftigten die Adlerwerke das dritt- größte Zwangsarbeiterheer Frankfurts, nach den IG Farben und VDM. Der Luftangriff vom 22.04.1944 führte zu schweren Zerstörungen bei den Adlerwerken. Dringend wurden weitere Arbeitskräfte benötigt. Um den Bedarf zu decken, forderten die Adlerwerke KZ-Häftlinge an. Am 22. August 1944 war das KZ Adlerwerke ein- gerichtet und erhielt den Decknamen „Katzbach“. Etwa 1.600 Männer wurden von der Werksleitung vorwiegend in den Konzentrationslagern Buchenwald und Dachau zur Sklavenarbeit ausgesucht.
Die Todesrate im KZ Adlerwerke übertraf die aller hessischen KZ-Außenlager. Die Häftlinge (aus acht Nationen, die meisten jedoch aus Polen) mussten 84 Stunden in der Woche in ungeheizten, teils zerstörten Hallen arbeiten. Sie besaßen in dem eisigen Winter 1944/45 nur ihre zerlumpten Sommermonturen. Hygiene und ärztliche Versorgung gab es praktisch nicht. Gewalt und Schikane waren alltäglich. Die Menschen verhungerten buchstäblich oder fielen, völlig geschwächt, Krankheiten zum Opfer. Fluchtversuche wurden mit öffentlicher Hinrichtung bestraft. Am 23. März 1945 stellte das Werk die Produktion ein, am nächsten Tag wurden die letzten verbliebenen Häftlinge auf einen Todesmarsch nach Buchenwald geschickt.
Der Förderverein setzt sich für eine dauerhafte und nachhaltige Erinnerung an die Zwangsarbeit in Frankfurt im Allgemeinen und an die Verbrechen im KZ Katzbach im Besonderen ein.